Fritz Bauer: Jurist, Jude, Remigrant und Generalstaatsanwalt
Autor*innen: Barbara Kettnaker, Historikerin, Slawistin, aufgewachsen in Stuttgart, ihr Großvater war zeitgleich mit Fritz Bauer im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, langjährige Referentin bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, aktuell freiberufliche Referentin für die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin. Und: Karl-Heinz Steinle, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt „Lebenswelten, Repression und Verfolgung von LSBTTIQ* in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus und der Bundesrepublik Deutschland“ der Universität Stuttgart; arbeitet auch freiberuflich, zuletzt u.a. als Co-Kurator der Wanderausstellung „gefährdet leben. Queere Menschen 1933-1945“ der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Berlin.
Der Text geht zurück auf einen Beitrag für den Katalog „Queer durch Tübingen. Vom Leben, Lieben und Kämpfen“, der 2021 im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung im Stadtmuseum Tübingen erschien.1 Die beiden Autor*innen engagieren sich seit über 10 Jahren für die posthume Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dr. Fritz Bauer und unterstützen auch aus diesem Grunde die aktuell laufende Petition vom VVN – Bund der Antifaschist:innen Baden-Württemberg und der AG queere Erinnerungskultur – „Der Liebe wegen“ der Weissenburg „Ehrenbürgerschaft der Stadt Stuttgart für Dr. Fritz Bauer“ vollumfänglich. Informationen zur Petition sind hier zu finden: https://www.openpetition.de/petition/online/ehrenbuergerschaft-fuer-fritz-bauer-auch-als-vorkaempfer-gegen-das-175-unrecht.
Fritz Bauer, den 1903 in Stuttgart geborenen Juristen, Juden und 1949 aus dem schwedischen Exil zurückgekehrten Remigranten, kennen Viele als Ankläger gegen NS-Verbrechen. Weniger bekannt ist, dass er sich auch zeitlebens für eine Humanisierung des Rechts einsetzte und sich in öffentlichen Beiträgen wie auch in seiner juristischen Praxis sowie als Mitglied der SPD für die Liberalisierung des Sexualstrafrechts ausgesprochen hat.
Von 1950 bis zu seinem unerwarteten Tod 1968 strengte Fritz Bauer trotz heftigster Widerstände Ermittlungen wegen NS-Verbrechen an. Bis 1956 war er Landgerichtsdirektor, später Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Braunschweig, wo er mit Prozessen auf den Deutschen Widerstand von 1944 und die Euthanasie-Morde auf sich aufmerksam machte. Als hessischer Generalstaatsanwalt in Frankfurt/Main machte er sich 1963 bis 1965 vor allem im Zuge des international beachteten Auschwitz-Prozesses unter den noch immer existierenden Seilschaften im Justizapparat viele Feinde. Damit hat Fritz Bauer den Finger in die offene Wunde der bis dahin verschwiegenen Verbrechen der NS-Justiz gelegt und einen ersten Schritt zu ihrer Aufarbeitung ermöglicht. Er hat die Deutschen zum Hinschauen gezwungen und den Nachweis erbracht, dass große Teile der Bevölkerung selbst an den Verbrechen beteiligt waren und alle davon gewusst haben müssten, wenn sie nicht die Augen verschlossen hätten.
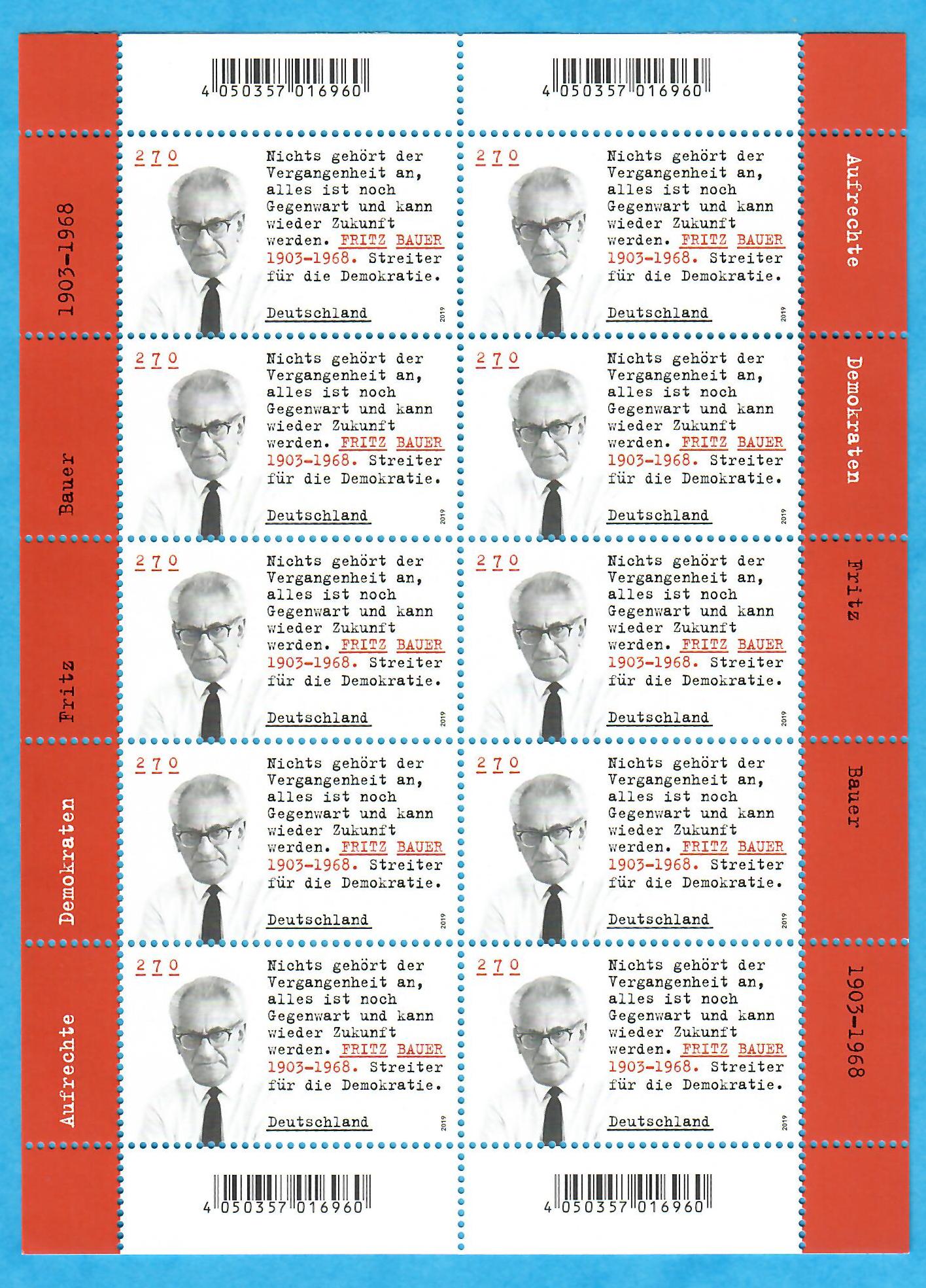
Fritz Bauer Briefmarke Maxibrief 2,70 €, Briefmarkenblock. Deutsche Post 2019, unter Verwendung einer Fotografie von Stefan Moses von 1965. Sammlung Karl-Heinz Steinle.
Die letzten Jahre der Schulzeit von Fritz Bauer waren geprägt vom Ersten Weltkrieg und den politischen Kämpfen um die Gründung der Weimarer Republik. Er schloss sich den Sozialdemokraten an und erlebte 1920 die Auswirkungen des rechtsnationalen Kapp-Putsches in Stuttgart. Dorthin hatten sich Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichsregierung abgesetzt und von dort aus den Generalstreik ausgerufen, der dem Umsturzversuch ein Ende setzte. Solchermaßen politisiert begann Fritz Bauer 1921 sein Jurastudium in Heidelberg, das er ein Jahr später in München fortsetzte. Ende 1923 kam er nach Tübingen, wo er auch zwei Semester evangelische Theologie studierte und 1924 seinen Abschluss machte.
Nach Abschluss des Studiums wurde Bauer Gerichtsassessor beim Amtsgericht Stuttgart, 1930 dessen Richter und war damit jüngster Amtsrichter Deutschlands. Politisch aktiv blieb er weiterhin: Seit 1920 SPD-Mitglied stand er im engen Austausch mit Kurt Schumacher (1895-1952), war Mitbegründer des Republikanischen Richterbunds und aktiv im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, einem politischen Wehrverband zum Schutz der demokratischen Republik. Aufgrund dieser Aktivitäten wurde er bald nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten am 23. März 1933 verhaftet und bis Ende des Jahres im Gefängnis und KZ Heuberg in Stetten am Kalten Markt auf der Schwäbischen Alb und im Ulmer Garnisonsarresthaus inhaftiert. Mittels des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, mit Hilfe dessen die Nationalsozialisten jüdische und politisch missliebige Beamt*innen aus dem Dienst entfernen konnten, wurde Fritz Bauer von seinem Richterposten abgesetzt und aus dem Staatsdienst entlassen.
1936 folgte Fritz Bauer seiner Schwester Margot und ihrem Mann ins Exil nach Dänemark. Dort ging er im Juni 1943 mit der Kindergärtnerin und Genossin Anna Maria Petersen (1903-2002) eine Schutzheirat ein. Ob er dies tat, weil er in Gefahr stand, als Ausländer ausgewiesen zu werden, oder ob er damit den Verdacht der dänischen Fremdenpolizei, er pflege Umgang mit männlichen Prostituierten, aus dem Weg räumen wollte, ist nicht bekannt. Als die Nationalsozialisten im Oktober 1943 mit Deportationen der dänischen Juden ins KZ Theresienstadt begann, tauchte Fritz Bauer unter und floh weiter nach Schweden. Er wurde wie viele dänische Jüd*innen von Fischern über den Öresund gerettet. Dort arbeitete er als Archivgehilfe und gründete zusammen mit dem späteren Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992) und anderen die Zeitschrift „Sozialistische Tribüne“.
Auf Betreiben von Kurt Schumacher, mittlerweile SPD-Vorsitzender, kehrte Fritz Bauer 1949 nach Deutschland zurück. Zu seiner Ehefrau Anna Maria, die in Dänemark blieb, hielt er weiterhin Kontakt. In der frisch gegründeten Bundesrepublik beteiligte er sich als Jurist und überzeugter Demokrat am Aufbau demokratischer Strukturen. Die persönliche Geschichte von Fritz Bauer wurde dabei zum Politikum: Seine jüdischen Wurzeln hat er nicht mehr erwähnt. Denn er befürchtete, dass ihm sonst sein gesamtes Engagement als Rache ausgelegt werden könnte und nicht als Beharren auf eine demokratische Rechtsprechung. Trotzdem verging keine Woche, in der er nicht mehrere Morddrohungen bekam.2
Und auch seine Homosexualität lebte Fritz Bauer nicht offen aus. Seine Freundschaft zu Thomas Harlan (1929-2010), Sohn des NS-Propagandafilmers Veit Harlan und selbst skandalumwitterter Regisseur und Autor, war wohl platonischer Natur. Bauer scheint von dessen bohèmehaften Lebensstil angezogen gewesen zu sein: Der junge Harlan hatte mit dem Schriftsteller Michel Tournier (1924-2016) in Tübingen Philosophie studiert und den Schauspieler Klaus Kinski (1926-1991) kennengelernt, mit dem er den frisch gegründeten Staat Israel bereiste. Bekannt geworden war Harlan als Enthüller ehemaliger Nazigrößen, die in der Bundesrepublik wieder Posten bekleideten, vor deren Verleumdungsklagen er sich medienwirksam nach Polen absetzte.3
Bauers Zurückgezogenheit hatte sicherlich auch taktische Gründe. So vermied er nicht nur den Vorwurf, aus eigener Betroffenheit zu handeln, er schützte sich auch vor Erpressungen. Denn während Bauers gesamter Zeit als Landesgerichtsdirektor und Generalstaatsanwalt waren alle homosexuellen Handlungen noch unter Strafe gestellt. Schon kurz nach seiner Remigration setzten 1950 und 1951 die sogenannten Frankfurter Prozesse ein deutliches Zeichen: Mit von den Nationalsozialisten übernommenen Ermittlungsmethoden und unter Vorsitz eines Richters, der schon im Nationalsozialismus für seine Härte gegen Homosexuelle bekannt war, wurden 240 Ermittlungen gegen Homosexuelle eingeleitet, denen 100 Verhaftungen folgten, die zu Urteilen mit drakonischen Strafen führten und mehrere Selbsttötungen von Betroffenen nach sich zogen.
Fritz Bauer hielt sich zwar persönlich bedeckt, beteiligte sich aber mit zahlreichen Publikationen an der Reformdebatte um den Paragrafen 175 und sprach sich für eine weitgehende Straffreiheit von Homosexualität aus. Schon 1952 versuchte er als Landesgerichtsdirektor in Braunschweig – wenn auch erfolglos – vom Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit des Paragrafen 175 überprüfen zu lassen.4 Im Dezember 1960 beteiligte er sich an der Tagung „Sexuelles Verhalten und Gesetzgebung des Staates“ der heutigen Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart-Hohenheim.5 Mit dem von der Bundesregierung 1962 vorlegten Entwurf für ein neues Sexualstrafrecht, das am Paragrafen 175, der Bestrafung der Kuppelei, Abtreibung und Verbreitung unzüchtiger Schriften in unveränderter Form festhielt, befasste sich Fritz Bauer intensiv. Er kritisierte, dass der Entwurf von einer autoritären Mentalität geprägt sei und rekurrierte damit auch auf dessen inhärente NS-Ideologie.
Als eine erste gewichtige Reaktion darauf gab Fritz Bauer 1963 die Aufsatzsammlung „Sexualität und Verbrechen“ heraus.6 In dem rasch vergriffenen und über 50.000 Mal verkauften Kompendium von Gegenargumenten versammelte Bauer den führenden Sexualforscher Hans Giese (1920-1970) und den Psychiater Hans Bürger-Prinz (1897-1976) sowie bekannte Autoren aus anderen Fachrichtungen wie Theodor W. Adorno (1903-1969) oder Helmut Thielicke (1908-1986), ab 1945 Professor für Evangelische Ethik an der Universität Tübingen und von 1951 bis 1954 ihr Rektor. Die Liberalisierung des Paragrafen 175 im Jahr 1969 erlebte Fritz Bauer nicht mehr. Er wurde am 1. Juli 1968 tot in der Badewanne seiner Wohnung in Frankfurt am Main aufgefunden.
Bei all seinem Engagement war es Fritz Bauer ein großes Anliegen, die Gesellschaft und vor allem die Jugend zur Teilhabe und zum aktiven Mitmachen im demokratischen Prozess zu bewegen. Nach seinem Verständnis waren es die Bürger*innen, die das Recht lebten und nicht die Jurist*innen. Im Gegensatz zum überwiegenden Teil seiner Kolleg*innen begab er sich zu seinem Publikum und praktizierte ungewöhnliche Vermittlungswege und -formate. Dies verschaffte ihm das Image des Reformers und ein hohes Maß an Prominenz. Er schrieb Beiträge im Jugendmagazin „twen“, nahm an vielen Diskussionen und Streitgesprächen teil und sprach in zahlreichen Radiobeiträgen über einzelne Aspekte der Rechtsprechung. Als eine der Sternstunden des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gilt heute noch die am 8. Dezember 1964 vom Hessischen Rundfunk ausgestrahlte Diskussionssendung „Heute Abend Kellerclub“, in der Fritz Bauer inmitten junger Menschen sitzt und sie immer wieder auffordert, sich in gesellschaftlichen Prozessen zu engagieren.7
Trotzdem geriet Fritz Bauer nach seinem Tod mehr und mehr in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren wurde er als Vorkämpfer für die neue Demokratie nach dem Nationalsozialismus wieder entdeckt. 2014 und 2015 erschienen gleich mehrere Filme über ihn, darunter zwei auch international erfolgreiche Kinofilme, die Fritz Bauer als knarzigen Menschen mit unverwechselbarem schwäbischen Akzent wie eine wandelnde Trutzburg zeigen. Der Regisseur Lars Kraume thematisiert 2014 in seinem Spielfilm „Der Staat gegen Fritz Bauer“ auch Bauers Homosexualität und die Schwierigkeit seines persönlichen Umgangs damit.8
Danach kam es zu vielen Ehrungen und Anerkennungen: Das Justizministerium etablierte 2013 den „Fritz Bauer Studienpreis für Menschenrechte und juristische Zeitgeschichte“. Eine private Initiative für ein posthumes Bundesverdienstkreuz für Fritz Bauer scheiterte jedoch bislang. 2019 erschien eine Briefmarke. Sie zeigt ein Fotoporträt Fritz Bauers mit seinem bekannten Ausspruch „Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden“. Das Foto stammt aus einer 1965 entstandenen Serie des Porträtfotografen Stefan Moses (1938-2018), wie Bauer ein Remigrant. Die Porträts von Moses zeigen Fritz Bauer an seinem Schreibtisch in der Pose des Machers, im Hintergrund die avantgardistische Tapete von Le Corbussier, die Fritz Bauer als bedeutendes Zeichen der Neuerung bei seinem Einzug in seinem Büro hat anbringen lassen. Diese ist allerdings auf der Briefmarke wegretuschiert.
1 Steinle, Karl-Heinz / Kettnaker, Barbara: Fritz Bauer. Jurist, Jude, Remigrant und Generalstaatsanwalt, in: Blattner, Evamarie / Ratzeburg, Wiebke / Rauch, Udo (Hg.): Queer durch Tübingen. Geschichten vom Leben, Lieben und Kämpfen. Tübingen 2021, S. 121-125
2Siehe hierzu Fritz Bauer Institut u. Rauschenberger / Katharina (Hg.): Rückkehr in Feindesland? Fritz Bauer in der deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte (Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, 17), Frankfurt am Main 2013.
3Zu Thomas Harlan siehe u.a. Stephan, Jean-Pierre: Thomas Harlan. Das Gesicht deines Feindes. Ein deutsches Leben, Frankfurt am Main 2007.
4 Renz, Werner: „Wider die Sittenwächter.“ Fritz Bauers Kritik am überkommenen Sexualstrafrecht der 1950er und 1960er Jahre, in: Jahrbuch der Sexualitäten, hrsg. von Maria Borowski et al., Göttingen 2017, S. 70-93.
5Siehe zur Tagung Munier, Julia Noah / Steinle, Karl-Heinz: Christliche Kommunikationsräume zur Homosexualität zwischen Repression und Anerkennung. Von den Strafrechtsreformdebatten im Akademiekontext der 1960er Jahre zu den Lesbentagungen in Bad Boll (erscheint 2025).
6 Bauer, Fritz et al (Hg.): Sexualität und Verbrechen. Beiträge zur Strafrechtsreform, Frankfurt am Main 1963
7Siehe hierzu Wojak, Irmtrud: Junge Leute diskutieren mit Prominenten, https://fritz-bauer-forum.de/de/ueber-fritz-bauer/filme/heute-abend-kellerclub/. Die Sendung vom 8. Dezember 1964 ist auch auf YouTube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=72XO8-zrJe8.
8Siehe hierzu: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Staat_gegen_Fritz_Bauer.

Pingback: DER LIEBE WEGEN
Pingback: Ehrenbürgerschaft für Fritz Bauer: Stadt Stuttgart bringt neue Ehrungsform in Gespräch | Stuttgart PRIDE | CSD Stuttgart